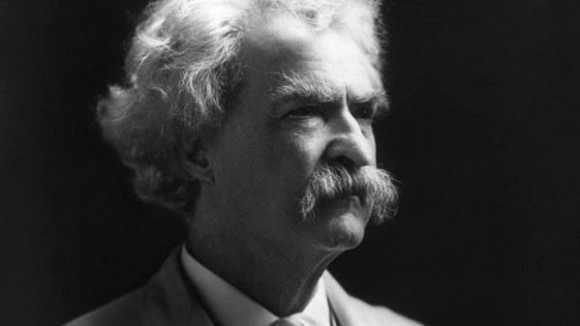Mathias Döpfner beim nächsten Rekord. Bilanzpressekonferenz 2013.
Für die aktuelle Print-Ausgabe des „Stern“ hat jemand den Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer, Mathias Döpfner, interviewt. Von dem spektakulären Verkauf der Regionalzeitungen und Zeitschriften Springers an die Funke-Gruppe ist noch nicht die Rede, sie war dem „Stern“ zum Zeitpunkt des Gesprächs sicher nicht bekannt. Aber dass die Ausgabe an dem Tag erschien, an dem der 920-Millionen-Euro-Deal wie eine Bombe in die Medienwelt einschlug, war für Döpfner wohl nicht ganz zufällig.
Im Interview geht es um Richard Wagner, um Opern (wovon ich leider nicht viel verstehe) und schließlich auch um Axel Springer. Der Mann vom „Stern“ – tapfer, aber auf der ganzen Linie überfordert – versuchte Döpfner u. a. nachzuweisen, dass die Marke Axel Springer wie eine Oper inszeniert werde. Er spielte auf das Spektakel um den USA-Aufenthalt von „Bild“-Chef Kai Diekmann an. Döpfner antwortete sinngemäß, für Springer und seine Manager sei es eine Fortbildungs- und Innovationsmaßnahme gewesen. Zur Oper hätten es Journalisten anderer Verlage gemacht-. Woran man sie nicht hindern könne.
Das stimmt. Zu jeder Oper gehören zwei Seiten: die, die sie inszeniert, und die, die sie sehen und darüber reden will.
Wir dürfen Döpfner und Diekmann unterstellen, dass sie die große Medienoper lieben. Aber nur wir, die Öffentlichkeit, machen diese Oper möglich. Der beste Beweis dafür sind die theatralischen Reaktionen auf den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften an die Funke-Gruppe.
Was ist geschehen? Springer gibt einen hochprofitablen Geschäftsbereich mit 18,5 Prozent Umsatzrendite ab, um sich auf seine wichtigsten Marken zu konzentrieren, „Bild“ und „Welt“. Für die betroffenen Mitarbeiter ist das eine schlimme Nachricht, da gibt es nichts zu beschönigen, auch wenn Springer selbst schreibt, es sei „das Beste“ für die Mitarbeiter (ein Satz, den man auch schon auf Beerdigungen gehört hat). Die Funke-Gruppe gilt als rücksichtslos kostenbewusst, das wissen nicht nur die gekündigten Mitarbeiter ihrer „Westfälischen Rundschau“. Hier darf und muss man sich Sorgen machen. Aber um was noch? Um Springer etwa?
Um das verlegerische Erbe von Axel Springer, den manche Kommentatoren schon im Grab rotieren sehen? Um die jetzt immer wieder bemühten „gekappten Wurzeln“ des Hauses Springer? Um den publizistischen Charakter des Unternehmens? Bitte nicht. Das ist Verlagsfolklore, die schon lange an der der Realität vorbei geht.
Die „Wurzeln“ des Hauses haben ein börsennotiertes Unternehmen nicht zu interessieren. Wenn es an der Börse um die „Wurzeln des Hauses“ gehen würde, dann produzierte VW immer noch den Käfer und Nokia Gummistiefel.
Funke könnte Medienmarken entkernen und Redaktionen poolen? Ja, das ist leider zu befürchten. Aber Springer selbst hat Funke es vorgemacht. Die jetzt verkaufte „Berliner Morgenpost“ hat Springer schon 2006 in eine Redaktionsgemeinschaft mit der „Welt“ zusammengelegt und das „Hamburger Abendblatt“ noch 2012 in diese Zwangsehe folgen lassen. Beide Medienmarken haben also schon jetzt keine Vollredaktionen mehr.
Und der publizistische Charakter des Springer-Konzerns? Das Fehlen eines „echten Verlegers“? Was soll das sein? Welcher Verlag hat denn noch einen Verleger? Der „Spiegel“ vielleicht, dessen Redakteur Markus Brauck genau das der Axel Springer AG vorhält? Nein, der Verleger des „Spiegel“ ist 2002 gestorben.
Und was hätte Axel Springer dazu gesagt? Dreht er sich jetzt wirklich im Grab um? Schon diese Klischee-Frage sollte sich jedem ernsthaften Medienjournalist verbieten. Sie passt besser in einen Inga-Lindström-Film im ZDF, Sonntags um 20 Uhr 15. Aber wer sie wirklich erörtern möchte, bitte: Er möge sich daran erinnern, dass Axel Springer die väterlichen „Altonaer Nachrichten“ ebenso unsentimental im „Abendblatt“ aufgehen ließ wie er seine Heimat Hamburg gegen Berlin eintauschte. Und wie traditions- und verlegerfamilienbewusst Axel Springer plante, das zeigt schon die heutige Funktion seiner Nachkommen im Konzern: es gibt keine.
Wir müssen das alles nicht gut finden. Wir können uns inhabergeführte Verlage mit starken Publizisten an der Spitze wünschen. Aber wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass die Realität eine andere und Axel Springer ein börsennotiertes Unternehmen wie jedes andere ist. Mit gierigen renditebewussten Aktionären wie anderswo auch. Und Mathias Döpfner dient diesen Aktionären. So wie andere Vorstandsvorsitzende auch.
A propos Rendite: 18,5 Prozent hat die verkaufte Springer-Sparte zuletzt eingefahren. Peter Turi (von dem man eigentlich sehr viel lernen kann) nennt das „renditeschwach“. Tatsächlich lag sie nur knapp unterhalb des Springer-Schnitts (19 Prozent), und der ist so hoch, dass den meisten deutschen Unternehmern schwindlig würde.
Überhaupt, die Zahlen. Hier muss man einen weiteren Mythos hinterfragen. Wir glauben ja gerne, dass früher alles besser war. In den goldenen Jahren. Um 2000. Als Print boomte und die Verlage nicht wussten, wo sie das Papier für ihre ganzen Anzeigen hernehmen sollten. Was glauben Sie, was Axel Springer im Boomjahr 2000 für eine Umsatzrendite herausgeholt hat? Und Gruner + Jahr? Noch mehr als 19 Prozent? Nein. Es war viel weniger: Noch nicht einmal zehn Prozent. Hier sind die Zahlen von Springer (2000) und hier die von Gruner +Jahr (Geschäftsjahr 2000/2001). Womit wir beim eigentlichen Verdienst und der Mission von Mathias Döpfner wären: Nicht unerhörte digitale Revolution ist sein Auftrag, sondern unerhörte Rendite. Aus seiner und der Aktionäre Sicht ist das handelsüblich. Andere nennen es gewöhnlich. Es ist jedenfalls keine Oper.